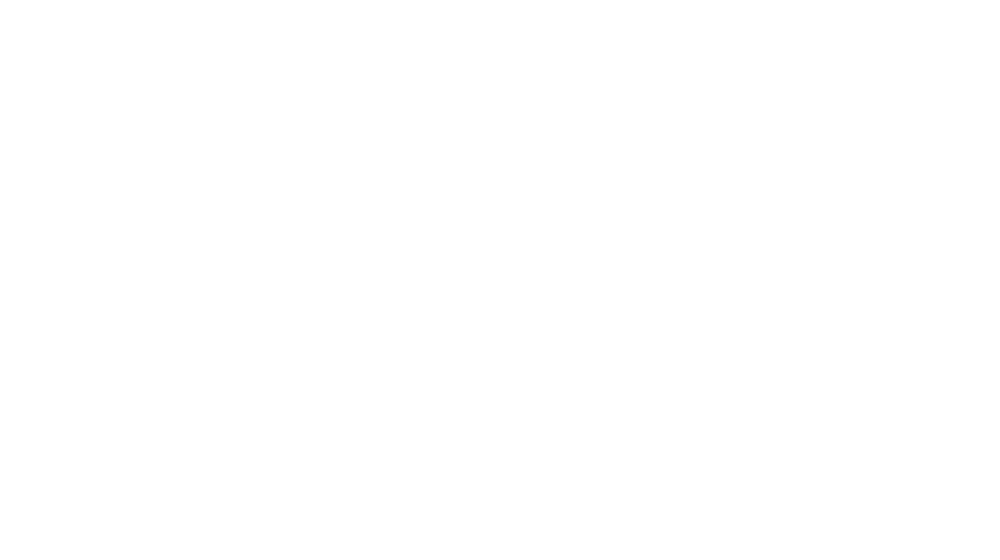Das Schwerpunktprogramm im Überblick
Gefördert durch:
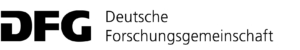
Aktuelles
Ausschreibung: Schwerpunktprogramm „Jüdisches Kulturerbe“ (SPP 2357) – zweite Förderperiode
Der Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im März 2021die Einrichtung des Schwerpunktprogramms „Jüdisches Kulturerbe“ (SPP 2357) beschlossen. Als Laufzeit sind sechs Jahre vorgesehen. Die DFG lädt hiermit ein zur Antragstellung für die zweite dreijährige Förderperiode.